Heutzutage wird fast jedem Neugeborenen in einem US-Krankenhaus kurz nach der Geburt die Ferse gestochen. Mit diesem Bluttest werden seltene, aber schwerwiegende körperliche Störungen wie Sichelzellenanämie und Schilddrüsenüberfunktion aufgespürt, deren schlimmste Auswirkungen durch eine frühzeitige Behandlung gemildert werden können.
Was wäre, wenn zusätzlich eine kleine Probe des Speichels jedes Babys an ein Labor geschickt würde, wo – für nur wenige Dollar – die DNA des Babys analysiert und eine Vielzahl von „Risikowerten“ zurückgegeben würde? Dies wären keine Diagnosen, sondern Prognosen: Dieses Baby hat ein erhöhtes Risiko, in 50 Jahren eine Herzkrankheit zu entwickeln. Dieses Baby hat ein überdurchschnittlich hohes Risiko, eines Tages an Depressionen oder Schizophrenie zu erkranken. Dieses Baby könnte einen sehr hohen IQ haben – oder einen niedrigen.
Robert Plomin, PhD, ein Psychologe und Genetiker am King’s College London, glaubt, dass diese Zukunft vor der Tür steht, und er begrüßt sie. In wissenschaftlichen Arbeiten und in seinem neuen Buch „Blueprint: How DNA Makes Us Who We Are“ (Wie die DNA uns zu dem macht, was wir sind) vertritt er die Ansicht, dass wir in naher Zukunft in der Lage sein werden, bei der Geburt etwas über unser Risiko für die Entwicklung fast aller denkbaren psychologischen und körperlichen Eigenschaften und Krankheiten zu wissen – unsere „polygenen Risikowerte“ – und dass dieses Wissen den Forschern helfen wird, neue Behandlungen und Interventionen zu entwickeln, und uns allen helfen wird, ein Leben zu führen, das besser zu unserer individuellen Natur passt.
„In 10 Jahren wird es als unethisch angesehen werden, es nicht zu tun“, sagt er voraus. „Wissen ist Macht; wer gewarnt ist, ist gewappnet.“
Kritiker halten diese Vision für übertrieben und erschreckend – wissenschaftlich unplausibel, aber auch ethisch problematisch. Der Psychologe Eric Turkheimer von der University of Virginia beispielsweise wendet sich gegen den Vergleich mit der Kristallkugel und argumentiert, dass polygene Risikowerte nicht wirklich mehr aussagen als das, was wir bereits erfahren könnten, wenn wir uns einfach die Eigenschaften der Eltern einer Person ansehen.
Unbestreitbar ist jedoch, dass die Kosten für die DNA-Genotypisierung im letzten halben Jahrzehnt drastisch gesunken sind und die Forschung über die Genetik psychologischer Eigenschaften exponentiell zugenommen hat. Forscher haben Tausende von genetischen Variationen entdeckt, von denen jede einen winzigen Teil zu unserer genetischen Neigung zu einer Vielzahl von Merkmalen beiträgt. Und unabhängig davon, ob diese DNA-Tests viel über das Schicksal eines einzelnen Neugeborenen aussagen können, sind sie bereits ein nützliches Forschungsinstrument, das neue Einblicke in die Wechselwirkung zwischen Genen und Umwelt, neue Wege zum Verständnis der Entstehung psychischer (und anderer) Krankheiten und neue Wege zur Erforschung potenzieller Behandlungen eröffnet.
Eine Geschichte der Vererbung
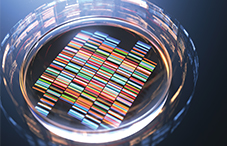 Der Weg zu polygenen Risikowerten war kurvenreich. Wissenschaftler untersuchen die Vererbung seit mehr als einem Jahrhundert, seit Sir Francis Galton vorschlug, Zwillinge zu verwenden, um das Mysterium von Natur und Veranlagung zu enträtseln. Jahrzehntelange Zwillings-, Adoptions- und andere Familienstudien führten zu einer allgemeinen Schlussfolgerung: „Alles ist vererbbar“, wie es Turkheimer in seinem „ersten Gesetz der Verhaltensgenetik“ formulierte.
Der Weg zu polygenen Risikowerten war kurvenreich. Wissenschaftler untersuchen die Vererbung seit mehr als einem Jahrhundert, seit Sir Francis Galton vorschlug, Zwillinge zu verwenden, um das Mysterium von Natur und Veranlagung zu enträtseln. Jahrzehntelange Zwillings-, Adoptions- und andere Familienstudien führten zu einer allgemeinen Schlussfolgerung: „Alles ist vererbbar“, wie es Turkheimer in seinem „ersten Gesetz der Verhaltensgenetik“ formulierte.
Der Grad der Vererbbarkeit variiert je nach Merkmal, ist aber bei den meisten psychologischen Merkmalen und Störungen erheblich. Schizophrenie ist zu etwa 50 Prozent vererbbar, d. h. die Gene sind für etwa 50 Prozent der Varianz des Merkmals in einer Population verantwortlich. Auch der IQ ist zu etwa 50 Prozent vererbbar. Autismus ist zu etwa 70 Prozent vererbbar. Und die Vererbbarkeit der Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale liegt zwischen 40 und 60 Prozent.
Das Wissen, dass ein Merkmal oder eine Störung teilweise vererbbar ist, sagt jedoch nur etwas über die Vererbung auf Bevölkerungsebene aus; es sagt nichts darüber aus, ob eine bestimmte Person das Merkmal vererben wird. Kein psychologisches Merkmal ist zu 100 Prozent vererbbar – schließlich haben eineiige Zwillinge genau denselben genetischen Code, aber sie sind nicht dieselbe Person. Und die Kenntnis der Vererbbarkeit eines Merkmals sagt nichts über die tatsächlichen Gene – oder die Umweltmechanismen – aus, die es beeinflussen. Forscher konnten erst in den 1990er und frühen 2000er Jahren damit beginnen, diese Fragen zu untersuchen, als die DNA-Genotypisierung verfügbar wurde.
Zunächst eine kurze Einführung: Das menschliche Genom besteht aus etwa 3 Milliarden Basenpaaren (die aus chemischen Bausteinen namens A, C, T und G bestehen) auf 23 Chromosomenpaaren. Der überwiegende Teil des Genoms ist von Mensch zu Mensch identisch, aber was die Forscher interessiert, sind die Unterschiede – die so genannten Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs), bei denen z. B. ein Buchstabe, der normalerweise ein G ist, durch ein T oder ein C durch ein A ersetzt wurde -, die zu unserer Vielfalt als Spezies beitragen.
In den Anfängen war die DNA-Genotypisierung sehr teuer. Daher wandten Forscher in der Psychologie und anderen Bereichen eine vielversprechend erscheinende Strategie an: Anstatt im gesamten Genom einer Person nach interessanten SNPs zu suchen (was zu teuer gewesen wäre), untersuchten sie „Kandidatengene“ – Gene, von denen sie guten Grund zu der Annahme hatten, dass sie mit dem untersuchten Merkmal in Zusammenhang stehen könnten. Ein Forscher, der sich für Depressionen interessiert, könnte beispielsweise SNPs auf einem oder zwei Genen untersuchen, die am Serotonin-System beteiligt sind.
Die Hoffnung war, dass diese Studien schnell „das Gen“ für Depressionen, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen (ADHS), IQ und viele andere Merkmale und Störungen identifizieren würden.
„Man ging davon aus, dass es interessant wäre, an einzelnen Genen zu arbeiten“, sagt Terrie Moffitt, PhD, eine Psychologin an der Duke University, die in den 1990er und frühen 2000er Jahren an Kandidatengenstudien gearbeitet hat.
Die Strategie ging nicht auf. Als die meisten Kandidatengenstudien keine interessanten Ergebnisse erbrachten (oder sich nicht wiederholen ließen), erkannten die Forscher allmählich, dass das Problem darin bestand, dass jedes psychologische Merkmal oder jede psychische Störung nicht nur mit einem oder zwei oder einem Dutzend Genen verbunden war, sondern mit Hunderten oder sogar Tausenden, von denen jedes nur einen winzigen Anteil an der Erblichkeit des Merkmals hatte. Um all diese SNPs zu finden, konnte man nicht nur nach Kandidatengenen suchen, sondern musste das gesamte Genom durchsuchen. Und da der Anteil der Varianz, den jeder einzelne SNP zu dem Merkmal beiträgt, so winzig ist, muss man dies über riesige Probandenpools – Hunderttausende von Menschen – tun, um die relevanten SNPs zu finden.
„Von etwa 2003 bis 2012 haben alle nur auf diese großen GWAS gewartet“, sagt Moffitt.
Schließlich, als die Kosten für die Genotypisierung zu sinken begannen, wurden diese Studien möglich und dann zahlreich. In den letzten fünf Jahren haben Forscher immer mehr und immer größere GWAS durchgeführt und dabei Tausende von SNPs identifiziert, die mit Persönlichkeit, Intelligenz, Depression und einer Vielzahl anderer psychologischer Merkmale und Störungen in Verbindung stehen (und außerhalb der Psychologie auch mit körperlichen Merkmalen und Krankheiten wie Fettleibigkeit und Herzerkrankungen).
Heutzutage kostet die Genotypisierung der DNA einer Person und die Suche nach Hunderttausenden von SNPs weniger als 100 Dollar, und Millionen von Menschen haben Abstriche an kommerzielle Unternehmen wie 23andMe geschickt, um persönliche Gentests durchzuführen. In einer der bisher größten GWAS untersuchten Forscher die Genome von mehr als 1,1 Millionen Menschen – darunter 23andMe-Kunden sowie Menschen in einer anderen riesigen DNA-Datenbank, der UK Biobank -, um nach Genen zu suchen, die mit dem Bildungsniveau in Zusammenhang stehen. Mit diesem riesigen Pool identifizierten sie 1.271 SNPs, die mit der Anzahl der Schuljahre zusammenhängen, die die Menschen in der Schule verbracht haben. Jeder SNP trug für sich genommen nur einen winzigen Teil bei, aber zusammengenommen erklärten sie 13 Prozent der Varianz des Bildungsniveaus in der Stichprobe (Nature Genetics, Vol. 50, No. 8, 2018). Ebenfalls im vergangenen Jahr fand eine Meta-Analyse von GWAS zu Depressionen mit fast 150.000 Menschen mit Depressionen und 350.000 Kontrollpersonen 44 Gene, die mit einer schweren depressiven Störung in Verbindung stehen (Nature Genetics, Vol. 50, No. 5, 2018). Und eine Studie mit 135.000 Menschen fand 35 Gene, die mit dem lebenslangen Cannabiskonsum in Verbindung stehen (Nature Neuroscience, Vol. 21, No. 9, 2018). Dies ist nur eine kleine Auswahl der wie Pilze aus dem Boden schießenden Zahl von GWAS.
Polygene Risikoscores sind also eine Möglichkeit, die Informationen aus GWAS zu nehmen und sie auf eine Person anzuwenden. „Polygen“ bedeutet „viele Gene“, und das ist es, was diese Risikowerte beinhalten. Sobald man die DNA einer Person genotypisiert hat, kann man sie nach SNPs durchkämmen, die – durch große GWAS – mit einem bestimmten Merkmal in Verbindung gebracht wurden. Dann addiert man einfach die Anzahl dieser SNPs in der DNA und gewichtet sie entsprechend, da einige SNPs stärker mit einem Merkmal verbunden sind als andere. Die resultierende Zahl ist der polygene Score der Person für dieses Merkmal. Er wird in der Regel als Perzentil ausgedrückt – so liegt diese Person beispielsweise im 70. Perzentil des genetischen Risikos für die Entwicklung von Schizophrenie oder im 90. Perzentil für akademische Leistungen.
Ein ethisches Minenfeld
 Wie wichtig sind also diese Werte und was sagen sie uns? Die Antwort hängt davon ab, wen Sie fragen. Turkheimer, der Skeptiker, ist nicht beeindruckt. Er weist darauf hin, dass die derzeit größte GWAS – die über den Bildungsstand – 13 Prozent der Bevölkerungsvarianz bei diesem Merkmal erklären kann. Andere GWAS zu psychologischen Merkmalen und Störungen erklären weniger – etwa 7 Prozent der Varianz bei Schizophrenie und 3 Prozent bei Depression, zum Beispiel. Obwohl dies für eine einzelne Variable signifikant ist, weist Turkheimer darauf hin, dass es weit weniger ist als die tatsächliche Erblichkeit dieser Merkmale, von der wir bereits aus Zwillings- und Adoptionsstudien wussten, dass sie hoch ist.
Wie wichtig sind also diese Werte und was sagen sie uns? Die Antwort hängt davon ab, wen Sie fragen. Turkheimer, der Skeptiker, ist nicht beeindruckt. Er weist darauf hin, dass die derzeit größte GWAS – die über den Bildungsstand – 13 Prozent der Bevölkerungsvarianz bei diesem Merkmal erklären kann. Andere GWAS zu psychologischen Merkmalen und Störungen erklären weniger – etwa 7 Prozent der Varianz bei Schizophrenie und 3 Prozent bei Depression, zum Beispiel. Obwohl dies für eine einzelne Variable signifikant ist, weist Turkheimer darauf hin, dass es weit weniger ist als die tatsächliche Erblichkeit dieser Merkmale, von der wir bereits aus Zwillings- und Adoptionsstudien wussten, dass sie hoch ist.
„Wenn überhaupt, dann ist das, was wir gefunden haben, geringer, als wir, sagen wir, 1990 erwartet hätten“, sagt er. „
Plomin hingegen, der sich selbst als „Cheerleader“ für polygene Scores bezeichnet, vertritt eine weitreichende Ansicht. Er ist der Ansicht, dass sich die Vorhersagekraft von GWAS mit zunehmender Größe und der Verfeinerung der Techniken zur Berechnung von Risikowerten weiter verbessern wird, bis hin zu den Grenzen der Vererbbarkeit selbst.
Das ist eine technische Meinungsverschiedenheit, aber die größere Debatte ist auch philosophischer und ethischer Natur.
Plomin ist der Ansicht, dass diese Werte für Eltern, die bei der Erziehung ihrer Kinder Rat suchen, und für Menschen, die Einblick in ihre eigenen Stärken und Schwächen erhalten wollen, von unschätzbarem Wert sein werden. Eltern mit einem Kind, bei dem ein hohes Risiko für Legasthenie besteht – eine Störung, die oft erst entdeckt wird, wenn das Kind bereits Schwierigkeiten in der Schule hat – könnten ihm stattdessen frühzeitige Lesehilfe zukommen lassen und so die schlimmsten Folgen abwenden. Menschen, die wissen, dass sie ein hohes Risiko für Alkohol- oder andere Drogenkonsumstörungen haben, könnten mehr darauf achten, Alkohol und Drogen frühzeitig zu vermeiden.
Aber Turkheimer und andere befürchten, dass diese Vorhersagen ein gefährliches Endspiel haben. Nehmen Sie zum Beispiel das Beispiel Legasthenie. Für jedes Kind, das anhand seiner DNA korrekt als Legastheniker identifiziert wird, könnten mehrere andere Kinder falsch identifiziert werden – schließlich zeigen polygene Risikowerte nur das Risiko an, sie sind keine Diagnosen. Welche Folgen hat es, wenn Kinder als „Hochrisikokinder“ für Störungen identifiziert werden, die sie nie entwickeln? Und ein noch extremeres Beispiel: Was wäre, wenn, wie von einigen vorgeschlagen, polygene Risikowerte für die Intelligenz zu einem Kriterium für die Einstufung von Kindern in verschiedene Bildungswege – Hochschule oder Berufsschule – würden? „Der Vorschlag, Kinder aufgrund ihrer polygenen Risikowerte in Schulen einzuteilen, ist genau dasselbe, wie sie aufgrund der IQ-Werte ihrer Eltern in Schulen einzuteilen, nur nicht so gut, weil die Vorhersagen nicht so gut sind. Für mich ist das ein durchschaubares, schreckliches Ergebnis“, sagt Turkheimer.
Im weiteren Sinne spielt die Konzentration auf das, was uns die Genetik über individuelle Unterschiede sagen kann, in eine Weltsicht hinein, die die Bedeutung der Umwelt auf gefährliche Weise vernachlässigt, sagt Jonathan Kaplan, PhD, ein Wissenschaftsphilosoph an der Oregon State University, der die Ethik der verhaltensgenetischen Forschung untersucht. Wenn man sich zum Beispiel darauf konzentriert, was GWAS uns über den IQ und den Bildungsstand eines Individuums sagen, kann man die Bedeutung des Besuchs einer sicheren, funktionalen und gut finanzierten Schule außer Acht lassen.
„Das ist die Sorge. Es ist nicht so, dass an der Forschung etwas falsch wäre, aber sie neigt dazu, andere Erklärungen in einer Weise zu verdrängen, die sehr problematisch ist“, sagt er.
Folgen für die Forschung
 Abgesehen von diesen tiefgreifenden – und wichtigen – gesellschaftlichen Folgen sind sich die meisten Forscher einig, dass GWAS und polygene Risikowerte zunehmend nützliche Forschungsinstrumente sind.
Abgesehen von diesen tiefgreifenden – und wichtigen – gesellschaftlichen Folgen sind sich die meisten Forscher einig, dass GWAS und polygene Risikowerte zunehmend nützliche Forschungsinstrumente sind.
Erstens, für die medizinische Forschung, könnte das Auffinden tausender neuer Gene, die mit psychischer Gesundheit und anderen Störungen zusammenhängen, den Wissenschaftlern neue Wege für die Suche nach neuen Medikamenten und anderen Behandlungen eröffnen. Natürlich war dies einst die Hoffnung, die hinter den Studien über Kandidatengene stand – dass wir durch das Auffinden von ein oder zwei Genen, die für eine Störung verantwortlich sind, und die Untersuchung der Systeme, an denen diese Gene beteiligt sind, mehr darüber erfahren würden, wie die Störung zu behandeln ist. Die Tatsache, dass die meisten psychischen Störungen von vielen Genen beeinflusst werden, hat dieses Bild erheblich erschwert, aber nicht ausgelöscht.
„Es hilft uns, die Biologie hinter diesen Störungen zu verstehen“, sagt Gerome Breen, PhD, ein psychiatrischer Genetiker am King’s College London. „Jüngste Studien helfen uns, unser Denken und unsere Herangehensweise zu erweitern, zum Beispiel bei Depressionen, und über andere biologische Prozesse nachzudenken, als wir bisher hatten. Sie könnten uns von der serotonindominierten Herangehensweise abbringen.“
Sie könnten auch die Art und Weise beeinflussen, wie Psychologen und andere psychische Krankheiten konzeptualisieren und kategorisieren. Jüngste GWAS haben zum Beispiel gezeigt, dass es erhebliche Überschneidungen bei den Genen gibt, die an vielen verschiedenen psychischen Störungen beteiligt sind, darunter Schizophrenie, bipolare Störung, ADHS und Depression (Science, Vol. 360, No. 6395, 2018). Weitere Ergebnisse wie diese könnten Psychologen, Psychiater und andere Forscher dazu veranlassen, die diagnostischen Unterscheidungen zwischen diesen Störungen zu überdenken.
Schließlich könnten polygene Risikoscores Forschern helfen, die personalisierte Medizin in die Behandlung psychischer Erkrankungen einzubringen und die Behandlung auf den Einzelnen zuzuschneiden. Breen interessiert sich beispielsweise dafür, wie polygene Risikoscores helfen könnten, das Ansprechen von Schizophreniepatienten auf die Behandlung vorherzusagen. In einer Studie fand er Hinweise darauf, dass bei Schizophrenie-Patienten, die eine Psychose in der ersten Episode erleben, diejenigen mit höheren polygenen Risikowerten für die Störung vor der Behandlung eher depressive Symptome und eine geringere globale Funktionsfähigkeit aufwiesen; sie zeigten aber auch tendenziell eine stärkere Verbesserung der Symptome nach der Behandlung im Vergleich zu Patienten mit niedrigeren polygenen Risikowerten (Translational Psychiatry, Vol. 8, No. 1, 2018).
Steven Hollon, PhD, ein Psychologe an der Vanderbilt University in Tennessee, der sich seit Jahrzehnten mit der Behandlung von Depressionen beschäftigt, ist von diesen Möglichkeiten begeistert. Sein Hintergrund ist nicht die Genetik, aber er arbeitet mit Breen und der Psychologin Thalia Eley vom King’s College London zusammen, um eine Studie zu entwickeln, in der untersucht werden soll, wie polygene Risikoscores das Ansprechen von Depressionspatienten auf eine Verhaltenstherapie im Vergleich zu einer medikamentösen Behandlung vorhersagen könnten. Frühere Forschungen hätten gezeigt, dass manche Patienten besser mit einer Verhaltenstherapie und andere besser mit Medikamenten zurechtkämen, aber im Moment gebe es nur wenige gute Möglichkeiten, um vorherzusagen, welche Patienten in welche Kategorie fallen würden. Der Antrag ist noch nicht bewilligt, aber Hollon setzt große Hoffnungen in die Forschungsmethode.
„Vor zwanzig Jahren hätten wir uns das nicht vorstellen können“, sagt er.
In einem anderen Forschungszweig haben polygene Risikowerte auch – vielleicht entgegen der Intuition – die Aufmerksamkeit von Psychologen und anderen Sozialwissenschaftlern auf sich gezogen, die mehr darüber wissen wollen, wie wir durch unsere Umgebung und unsere Gene geprägt werden.
Jahrzehntelang wurden solche Forschungen hauptsächlich durch Zwillings- und Adoptionsstudien durchgeführt. Wenn man zum Beispiel wissen wollte, wie sich die elterliche Erziehung auf ein bestimmtes Ergebnis bei Kindern auswirkt, konnte man eineiige Zwillinge suchen, die in verschiedenen Familien aufwuchsen, und sehen, wie sie sich in diesem Ergebnis unterschieden, oder man konnte eineiige mit zweieiigen Zwillingen vergleichen. Das ist eine effektive Methode, allerdings mit einem begrenzten Teilnehmerkreis.
Polygene Risikowerte bedeuten theoretisch, dass man ähnliche Studien in der allgemeinen Bevölkerung durchführen könnte, indem man die Risikowerte als Kovariate zur Kontrolle der Genetik verwendet.
In einer Studie kombinieren Moffitt, ihr Kollege und Ehepartner Avshalom Caspi, PhD, und Jasmin Wertz, PhD, polygene Risikowerte für den Bildungsstand mit langjährigen Kohortenstudien in Neuseeland und dem Vereinigten Königreich, um zu untersuchen, wie die elterliche Erziehung das lebenslange Risiko für antisoziales Verhalten bei Kindern beeinflusst. (Viele Forscher sind daran interessiert, diese Werte für das Bildungsniveau zu verwenden, um andere Bereiche zu untersuchen, da die GWAS für das Bildungsniveau die bisher größte ist und daher die beste Vorhersagekraft hat.
Und da das Bildungsniveau mit so vielen Merkmalen zusammenhängt, kann es als Stellvertreter verwendet werden, um viele Faktoren zu untersuchen, die statistisch mit dem Bildungsniveau verbunden sind, einschließlich kriminelles Verhalten, Langlebigkeit und mehr.)
„Wir nehmen die DNA der Mutter und berechnen den genetischen Wert für das Bildungsniveau“, erklärt Moffitt. „Dann schauen wir uns an, was sie tut – wir machen Hausbesuche und befragen die Eltern, wie oft sie Bücher lesen und so weiter.“ Dann werden die DNA der Kinder und die Ergebnisse untersucht, zum Beispiel, ob sie vorbestraft sind. „Verhaltensgenetiker würden sagen: Sicher, kluge Kinder sind gut, weil sie von klugen Eltern geboren werden. Aber durch die Kontrolle der polygenen Risikowerte können wir sagen, dass das Lesen von Büchern und der Musikunterricht eine Rolle spielen – ganz abgesehen von der Genetik“, sagt Moffitt.
Studien wie diese zeigen die große Reichweite der polygenen Risikowerte als Forschungsinstrument. Für Skeptiker wie Turkheimer liegt genau darin ihre Bedeutung. „Es gibt viele interessante sozialwissenschaftliche Untersuchungen, die man mit diesen genetischen Schätzungen durchführen kann“, sagt er. Für Befürworter wie Plomin hingegen sind sie ein weiterer Beweis dafür, dass alle Psychologen – auch diejenigen, die nie in Erwägung gezogen haben, die Genetik in ihre Arbeit einzubeziehen – diesem Bereich Aufmerksamkeit schenken sollten.
„Alle Psychologen sollten die Gelegenheit nutzen, die DNA in ihre Forschung einzubeziehen“, sagt Plomin. „Es kostet was, 100 Dollar? fMRI kostet vielleicht 500 Dollar pro Stunde. Wenn ein Psychologe keine DNA-Probe sammelt, erweist er sich selbst einen Bärendienst.“